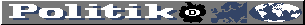
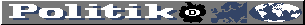
Peter Frisch erklärte anschaulich, woran man eine verfassungsfeindliche Partei erkennt: "Sie nutzt das Parlament vorrangig als Tribüne für ihre Propaganda. Das entspricht aber nicht dem vom Grundgesetz vorgesehenen Zweck der Ausübung der vom Volk ausgehenden Staatsgewalt." Kritisierend fuhr er fort: "Ich vermisse auch den Willen, das Bekenntnis zum Grundgesetz und zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung innerhalb der Partei durchzusetzen." Doch obwohl das Interview mit dem Verfassungsschutz-Chef im SPIEGEL 6/1999 gerade mal einen Tag nach der hessischen Landtagswahl erschien, meinte Frisch nicht die CSU, die ihren Münchener Statthalter Peter Gauweiler selbst dann nicht zur Ordnung rief, als dieser sich im Umfeld der umstrittenen Wehrmachtsausstellung ganz ungeniert mit Ultrarechten und Rechtsradikalen fraternisierte. Und er meinte auch nicht die CDU, die mit ihrer Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gerade erfolgreich außerparlamentarisch gegen einen parlamentarischen Entscheidungsfindungsprozeß agitiert hatte. Nein, Frisch sprach von der PDS. Dennoch passt seine Analyse in bemerkenswerter Weise auch auf das Bild, das die konservativen "C"-Parteien in letzter Zeit abgeben. Entwickelt sich hier ein Staatsfeind in Schwarz ?
Seitdem die ureigenen Gegner der nach dem Krieg neugegründeten "christlichen" Parteien, die Sowjetoligarchien Osteuropas, weggefallen waren, wurde allenthalben eine Sinnkrise der Linksintellektuellen konstatiert. Das war jedoch nur die halbe Wahrheit. Auch die konservative Geisteselite musste mit einer völlig neuen Situation fertig werden. Der alle lagerinternen Differenzen überbrückende Fixpunkt, das "Reich des Bösen" (Ronald Reagan), war verschwunden, das abschreckende Beispiel für die vermeintlichen Folgen des Verlustes konservativer Wertorientierungen gab es nicht mehr. Dass dies die bürgerlichen Parteien vor weit größere Schwierigkeiten stellte als sozialdemokratische oder sozialistische durch den Wegfall des ja weitgehend schon seit langem nicht mehr als Idealvorbild empfundenen Ostblocks meistern mussten, wurde weltweit offenbar, nachdem in immer mehr Ländern ehedem rechte Regierungen von der linken Opposition bezwungen wurden - in den USA, Großbritannien, Frankreich und Ende letzten Jahres auch in Deutschland mussten die konservativen Kräfte schmerzhafte Wahlniederlagen einstecken. Ein neues "sozialdemokratisches Zeitalter" schien unmittelbar bevorzustehen. In einer solchen Situation hat der Unterlegene immer zwei Optionen. Entweder er öffnet sich und versucht gewisse Positionen des politischen Gegners zu übernehmen - so reüssierten Clinton, Blair und Schröder. Oder er verschärft die Gangart, zieht sich auf radikalere ideologische Positionen zurück und vertraut darauf, aus der daraus resultierenden gesellschaftlichen Polarisierung als Sieger hervorgehen zu können. Die Republikaner wählten in den USA die zweite Alternative und schufen so ein Klima, in dem brave Bürger die Menschenjagd auf Abtreibungsärzte gut heißen, und in dem nicht unbedeutende Teile der Bevölkerung der eigenen Regierung derart misstrauen, dass selbst Ammenmärchen von einer von Weißem Haus und UNO unterstützten Weltregierung, die Gegner mit schwarzen Hubschraubern jagen läßt, geglaubt werden. Diese Entwicklung machte auch vor Europa nicht halt - in Österreich instrumentalisierte der mittlerweile im Sumpf eigener Fehltritte und Verstrickungen versinkende Jörg Haider erfolgreich das altbewährte Sündenbockprinzip und in Frankreich stellt der Front National des mehrfach verurteilten Le Pen bereits mehrere Bürgermeister. Natürlich blieb auch Deutschland vor der Ideologisierung von rechts nicht verschont - mit der unsäglichen Asyldebatte, in deren Zuge die Republikaner politische Erfolge feiern konnten und an deren (vorläufigen) Ende auch die SPD nach rechts umkippte, erlebte die Bundesrepublik einen ersten Vorgeschmack auf die Möglichkeiten, die rechte Demagogen und Scharfmacher hierzulande immer noch haben. Der gefundene "Kompromiß" bleibt politisch untragbar und verfassungsrechtlich trotz des ihn bestätigenden Urteils des Bundesverfassungsgerichtes nach wie vor bedenklich. Er befriedete jedoch die Debatte und wurde dort gefunden, wo politische Entscheidungen in unserem Staatswesen hingehören: im Parlament. Welche Motive man der CDU Helmut Kohls auch unterstellen mag - ein Ausgleich zwischen dem Wunsch des "Mannes von der Straße" und den Rechten von Minderheiten zu finden, oder das rein opportunistische Streben nach Machterhalt - in jedem Falle respektierte sie weitgehend die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie. Anders ihre süddeutsche Tochter, die CSU. Selten hat ein hochrangiger Vertreter föderaler Staatsgewalt so offen zum Gesetzesbruch, zum Widerstand gegen eine Entscheidung eines höherrangigen Bundesorganes aufgerufen, wie es der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber bei seiner Attacke gegen das sogenannte "Kruzifix"-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes tat. Und auch in der Abtreibungsfrage scherte das CSU-geführte Bayern aus der mühsam geschlossenen Phallanx der Bundesländer aus, indem es die Anforderungen an einen straffreien Schwangerschaftsabbruch kühl kalkulierend weit über das allgemein praktizierte Niveau anhob. Alle geschilderten Beispiele betreffen äußerst heikle Themen, über die man in der Sache sicherlich trefflich streiten kann. Das eigentliche Problem liegt woanders - in der ablehenden Haltung gegenüber staatlichen Entscheidungen und Willensbildungsprozessen, die in den genannten CSU-Aktionen zum Ausdruck kommt, in der Aufkündigung des gesellschaftlichen Konsens über die Frage, wie in dieser Republik Politik gemacht wird.
All das blieb eine bajuwarische Besonderheit, solange in Bonn Helmut Kohls CDU schon aus Rücksicht auf ihre politische Führungsrolle im Lande solchen Tendenzen im großen und ganzen resistent gegenüberstand. Mit dem Wahldebakel, das den Pfälzer nicht nur aus der Regierungsbank sondern auch aus dem Amt als Parteivorsitzender spülte, sollte sich das jedoch ändern. Ein verwundeter Krieger ist ein gefährlicher Krieger - und so nutzte die ihre Wunden leckende christdemokratische Partei die erste Möglichkeit, die sich ihr bot, um mit Hilfe bewährter Rezepte den Mangel an echten Konzepten für einen Neubeginn zu überdecken. Bezeichnenderweise war es erneut Stoiber, der das Potential eines außerparlamentarischen Widerstandes gegen die von der rot-grünen Koalition im Wahlkampf angekündigten und Ende 1998 dann auch tatsächlich zum Gegenstand der aktuellen politischen Diskussion erhobenen Reform des Staatsbürgerschaftsrechtes erkannte. Wem der Stoiber-Vorschlag zunächst wie ein Witz erschien, waren die Kriterien, die im Regierungsmodell für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft doch so streng, dass sich wegen fehlenden Integrationswillens ("Mir san mir !") und unzureichender Verfassungstreue (der Freistaat ist das einzige Bundesland, das dem Grundgesetz nicht zugestimmt hat), sowie mangelnder Deutsch-Kenntnisse die wenigsten Bayern für die deutsche Staatsbürgerschaft hätten qualifizieren können, blieb alsbald das Lachen im Halse stecken. Denn diesmal folgte dem wohl insgeheim auf die Kanzlerschaft spekulierenden Bayern jetzt nicht nur die im Rest der Republik ob ihrer regionalen Absonderlichkeiten eher belächelte CSU. Trotz starker parteiinterner Opposition beschloss die CDU-Spitze um den Parteivorsitzenden Wolfgang Schäuble, unbarmherzig angetrieben von der bayerischen Schwesterpartei, eine Unterschriftenaktion für Integration und gegen die doppelte Staatsbürgerschaft durchzuführen. Nicht zu Unrecht wurde dabei das Lippenbekenntnis zur Integration ausländischer Mitbürger von der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend ignoriert. Schließlich ist ja die Ermöglichung der Integration auch in der rot-grünen Koalition konsensfähig, so dass zur Erreichung dieses Zieles außerparlamentarischer Aktionismus noch nicht einmal einen - Vorsicht, Wortspiel !- rechten Sinn macht. Und so nimmt es nicht wunder, dass die Kampagne der CDU gemeinhin auf den Widerstand gegen die Erleichterung der doppelten Staatsbürgerschaft reduziert wurde.
Aber auch das ist natürlich an sich ein vertretbares Anliegen. Die Schwierigkeiten, die die doppelte Staatsbürgerschaft mit sich bringt, sind hinlänglich bekannt. Und nicht ohne Grund verwies auch die SPD stets darauf, dass es nicht das Ziel des Gesetzesvorhabens sei, die doppelte Staatsbürgerschaft zum Idealzustand zu erheben. Nein, etwas anderes macht die Aktion der CDU so gefährlich. In einer repräsentativen Demokratie werden politische Leitentscheidungen vom Parlament getroffen - ob man das nun gut heißen mag oder nicht. Weder über die Wiederbewaffnung, die Ablehnung des Wiedervereinigungsangebotes Mitte der Fünfziger Jahre, den Beitritt zur NATO oder zur Europäischen Gemeinschaft, noch über die Wiedervereinigung oder den Maastrichter Vertrag mitsamt der Abschaffung der DM wurde dieser Entscheidungsmechanismus von den großen politischen Parteien ernsthaft angezweifelt. Stets akzeptierte die Opposition, so sie denn die Entscheidungen nicht oder nur zähneknirschend mittrug, den Primat der parlamentarischen Mehrheit. Dadurch wurde dieses Land regierbar, wurden ideologischen Konflikte im Deutschen Bundestag und nicht auf den Straßen der Republik ausgetragen, der innere Friede geschützt. Diesen Pfad hat die CDU mit der Unterschriftenaktion nun verlassen - mit unabsehbaren Folgen für unsere Gesellschaft. Sicherlich gehören kontroverse politische Themen in den Wahlkampf, und sicherlich gehört auch die Instrumentalisierung oder Schaffung von Neid zum bewährten Wahlkampfarsenal aller Parteien. Wie hier aber Roland Koch, der selbst im eigenen Bundesland weitgehend unbekannte Spitzenkandidat der hessischen CDU, im Hauruck-Verfahren die Unterschriftenaktion noch vor dem parteiintern festgelegten offiziellen Start beginnen ließ, zeugt vom völligen Verlust politischer Glaubwürdigkeit. Dies scheint auch auf anderen Parteien einen gewissen Reiz auszustrahlen. Denn obwohl weit mehr als 50% der bei der hessischen Landtagswahl abgegebenen Stimmen auf Parteien entfielen, die entweder das zur Diskussion stehende Staatsbürgerschatsmodell vertreten (SPD und Bündnis'90/Die GRÜNEN) oder sich zumindest gegen die Unterschriftenaktion und das apodiktische "Nein" zu Formen der doppelten Staatsbürgerschaft ausgesprochen hatten (F.D.P.), dauerte es keine 24 Stunden, bis SPD-Kanzler Schröder signalisierte, die "Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben ?"-Aktion der CDU als Akt demokratischer Willensbildung zu akzeptieren und das Gesetzesvorhaben in der geplanten Form aufzugeben. Da ist es nur ein Treppenwitz der deutschen Verfassungsgeschichte, dass es ausgerechnet die CDU war, die in der nach der Wiedervereinigung ins Leben gerufenen Verfassungskommission die von der damaligen Opposition geforderte Einführung direktdemokratischer Elemente verhindert hatte. Die Halbwertszeit politischer Überzeugungen ist bei den Christdemokraten offenbar mit dem Verlust der Macht in Bonn drastisch gesunken. Plötzlich jedenfalls scheint man keine Bedenken mehr zu haben, den Volkswillen in ideologisch aufgeheizter Stimmung zu ermitteln und ihn dann zur Außerkraftsetzung parlamentarischer Mehrheitsmeinungen zu instrumentalisieren. Wenn nicht einmal die Parteien, die hierzulande im politischen Gefüge eine wichtige Rolle spielen und über erhebliche Privilegien verfügen, die Spielregeln der repräsentativen Demokratie mehr einhalten, wenn sie sich gegen die demokratisch gewählte Volksvertretung erheben - wer könnte da vom Bürger noch ernsthaft Verfassungspatriotismus oder nur -treue einfordern ? Gerade diese ist aber, als gesamtgesellschaftlicher Konsens, in Zeiten der Werteglobalisierung und der zunehmenden Ökonomisierung privater Lebenssphären unabdinglich, soll diese Republik mehr sein als nur ein Selbstbedienungsladen für die Sieger im großen Kampf aller gegen alle. Gelingt es nicht, diesen Konsens zu wahren, dann kann sich die Frage nach der doppelten Staatsbürgerschaft schon recht bald von alleine erledigt haben - denn dann bestünde kein Anreiz mehr, die deutsche anzunehmen.
