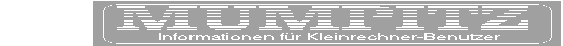
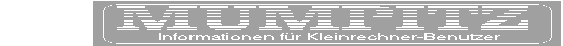
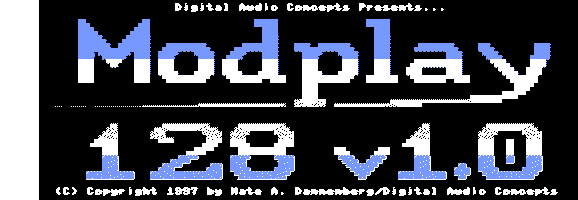
<< STUDIO38.SFX >>
So sieht ein Datei-Vorspann mit dem Programmnamen aus. Im unteren Beispiel ist sogar noch der Server eingetragen, der die Dateien übermittelte.
.UNI-LINZ.AC.AT
<< shados >>
Bei der letzten Datei auf einer Diskettenseite beißt sich die Katze in den Schwanz: Statt des richtigen Dateiendes findet man noch einmal die erste Datei; beim Einzel-Kopieren wird diese Datei stets länger als im Directory angegeben. Nur diese Datei mit dem (bzw. ohne) abgebissenen Schwanz ist verloren, alle anderen lassen sich retten, indem man sie aneinander klebt und die passenden Stücke wieder ausschneidet.
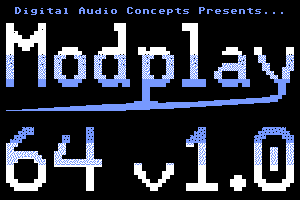
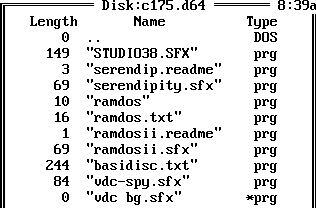 Links: Das typische Directory einer
unbrauchbaren Diskette im Star
Commander. Die letzte Datei konnte
nicht mehr geschlossen werden, da sie
wegen ihrer Verknüpfung mit der großen
ersten nicht mehr total auf die
Diskette passte.
Links: Das typische Directory einer
unbrauchbaren Diskette im Star
Commander. Die letzte Datei konnte
nicht mehr geschlossen werden, da sie
wegen ihrer Verknüpfung mit der großen
ersten nicht mehr total auf die
Diskette passte.
Mit einem Directory-Lister, der die
Startadressen ausgibt, dem BLOAD-Befehl und dem Systemmonitor ließe
sich dies auch auf dem C128
bewerkstelligen; da ich nicht vergnügungssüchtig bin, zog ich die Arbeit
mit DEBUG auf dem PC vor, was auch
noch Stunden dauerte.
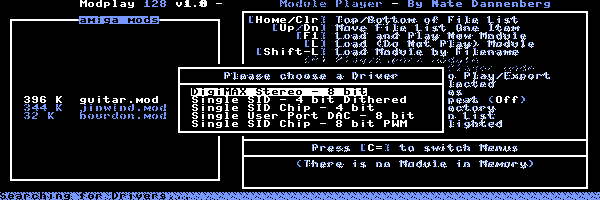 Den letzten C128-Treiber
(8 bit pulse width modulation), der
auf der Diskette fehlte, musste ich
erst aus dem mitgelieferten Quelltext
assemblieren lassen.
Den letzten C128-Treiber
(8 bit pulse width modulation), der
auf der Diskette fehlte, musste ich
erst aus dem mitgelieferten Quelltext
assemblieren lassen.
Glücklicherweise gibt es eine einfache und eine kompilierte Version des Basic-Hauptprogramms der 128er-Version, so dass die Unvollständigkeit der einfachen Version nicht ins Gewicht fiel. Die beschädigte Lautstärken-Tabelle PM.MONO USER.T ergänzte ich aus der Tabelle PM.MONO 8BIT.T, die sich nur in den ersten zwei Kilobyte unterschied.
Bei aufmerksamerer Lektüre des README
hätte ich mir die Arbeit mit der C64-Version
des Modplayers auf Abbild 2551
gespart. Diese benötigt nämlich
zusätzlich zur REU eine Super-CPU.
Dafür unterstützt sie auch einen
Stereo-SID und ermöglicht Ausgabe-Raten
um 42KHz, während die C128-Version
zwischen 8KHz und 12 KHz
arbeitet.
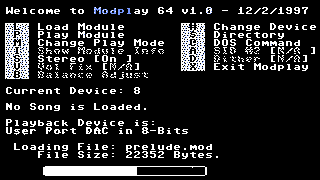
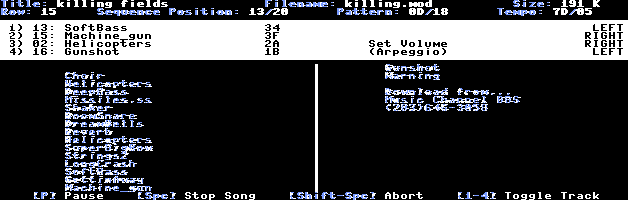 Diesen Bildschirm zeigt Modplay 128
beim Abspielen eines Moduls. Leider
haben nicht bei allen MODs die Samples
Namen; viele Angeber bringen dort
Greetinx oder Gelaber unter. Modplay
verarbeitet nur Module mit vier
Spuren, welche mit acht oder mehr habe
ich nicht getestet. Man kann sich auch
einzelne Samples ausgeben lassen.
Diesen Bildschirm zeigt Modplay 128
beim Abspielen eines Moduls. Leider
haben nicht bei allen MODs die Samples
Namen; viele Angeber bringen dort
Greetinx oder Gelaber unter. Modplay
verarbeitet nur Module mit vier
Spuren, welche mit acht oder mehr habe
ich nicht getestet. Man kann sich auch
einzelne Samples ausgeben lassen.
Modplay fängt nur wenige Fehler ab: So
überprüft es nicht, ob eine REU
angeschlossen ist und spielt auch
Daten aus einer nicht vorhandenen ab.
Bei einem Lesefehler der Floppystation
werden die Daten munter weiter in die
Speicherweiterung geschaufelt.
Amiga-Module können recht umfangreich
werden, wenn sie mit vielen Samples
bestückt sind. Als Speichermedium ist
daher eine 3,5"-Floppy wie die 1581 zu
empfehlen, die außerdem schneller als
die 5,25"-Laufwerke ist. Kopiert man
mit dem Big Blue Reader 128 MODs, die
größer als 64 KB sind, sollte man
vorher eine Speichererweiterung entfernen !
Mit einer 1571 als Zwischenspeicher
kann man maximal 319 KB große Dateien
von DOS-formatierten Disketten ziehen.
Mit dem Star Commander lässt sich aber
auch direkt auf eine am PC angeschlossene 1581 speichern; das falsche
Diskettenlabel irritiert nur.
Andere Leute schreiben sich Steuerpro- gramme ("Treiber"), um (neue) Geräte an einem bestimmten Rechner oder mit einem bestimmten Betriebssystem nutzen zu können. Ich bastele mir lieber die Geräte zu schon vorhandenen Treibern. Durch Analyse des Quelltexts für den DigiMAX-Treiber ermittelte ich das Funktionsprinzip dieses Geräts; es handelt sich um eine Kombination von vier 8Bit-Digital-Analog-Wandlern. Versuchshalber baute ich erst eine Sparversion, bei der jeweils zwei Spuren des Amiga-Moduls über einen Wandler ausgegeben werden. Mit gewissen Einschränkungen lässt sich auch damit eine passable Klangqualität erreichen; auf jeden Fall ist sie besser als bei der Ausgabe über den SID. Im Mono-Betrieb gibt es keinen Unterschied zu der Version mit vier D/A-Wandlern, da hier der Treiber die vier Spuren zu einer mischt.
Unten findet man den Schaltplan des Digital-Teils der Version mit zwei D/A-Wandlern. Diese bestehen aus einem 8Bit-Register mit Widerständen an den Ausgängen. Von Bit zu Bit verdoppelt sich der Wert des Widerstands; mangels passender Exemplare muss man die meisten aus zwei Bauteilen zusammensetzen. Über einen Entkopplungs-Kondensator gelangt die durch das Treiberprogramm mittels des Wandlers erzeugte Wechselspannung zum Operationsverstärker für den jeweiligen Kanal.
PA2 (Userport-Anschluss M) schaltet zwischen beiden Registern um; wenn PC2 (Anschluss 8) low wird,werden die über Port B der CIA ausgegebenen Spurdaten in das gerade angewählte Register übernommen. Indem PA2 doppelt invertiert auch an den Output-Enable-Anschluss beider Register gelegt wird, erreicht man eine ausgewogene Lautstärke der beiden Spuren pro Register. Legt man OE auf GND (wie bei der Vier-Wandler-Version erforderlich), ist die zweite Spur pro Kanal im Verhältnis zur ersten stets etwas zu laut.
| Spur | PA3 | PA2 |
| 1 Links | 1 | 0 |
| 2 Rechts | 1 | 1 |
| 3 Rechts | 0 | 0 |
| 4 Links | 0 | 1 |
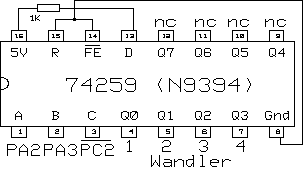
Zur Auswahl der vier Wandler dienen die am Userport verfügbaren Anschlüsse von Port der CIA, PA2 (M) und PA3 (9, wird sonst als SER. ATN IN benutzt). Bei Verwendung von nur zwei Registern muss man zwangsläufig eine rechte Spur mit einer linken mischen. Viele Tests zeigten, dass mit PA2 als Umschalter der Stereo-Effekt bei den meisten Stücken besser zur Geltung kommt.
Nur der Chip 74(LS)259 ermöglicht die Anwahl von vier Registern ohne zusätzliche Gatter. (Die Taktanschlüsse der Register übernehmen die Daten bei high-Pegel, die Ausgänge aller anderen Dekoder-Chips sind jedoch low-aktiv.) Beim 74259 lässt sich die Polarität des aktiven Ausgangs am D- Eingang einstellen.
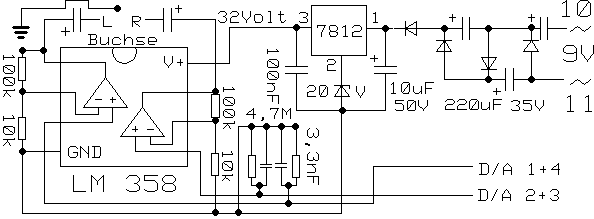
Vorseite: Der Analog-Teil zur Verstärkung der Wandler-Impulse. Diese werden auf die nichtinvertierenden Eingänge eines Zweifach-Operationsverstärkers geführt. Der 3,3nF-Kondensator soll das durch Hard- und Software erzeugte Rauschen wegfiltern; je größer seine Kapazität ist, umso mehr Höhen verschwinden. Durch die 100k+10k-Widerstände ergibt sich eine elffache Verstärkung. Die Ausgangsignale kann man über 47uF-Elkos an eine Stereo-Klinkenbuchse legen. Der benutzte Operationsverstärker kommt mit einer einfachen Spannungsversorgung aus. Die maximal zulässige Spannung von 32Volt baut eine Spannungsvervierfacher-Kaskade auf, die von der 9V-Wechselspannung am Userport gespeist wird. Als Dioden kann man den Standardtyp 1N4148 benutzen. Mit einer 20V-Z-Diode wird ein 12Volt-Festspannungsregler zum 32Volt-Regler umfunktioniert.
Der OP LM358 wird auch unter folgenden Typenbezeichnungen angeboten: CA 358, LT 1013, TA 75358. Ersatzweise läßt sich auch ein LM 392 benutzen.
Ähnliche Schaltungen gibt es auch für den Druckerport eines PCs. Die hier vorgeführte lässt sich leicht zur Verwendung an anderen Heimrechnern abwandeln. Die aufwendige Bastelei wird durch interessante Hörerlebnisse belohnt werden !
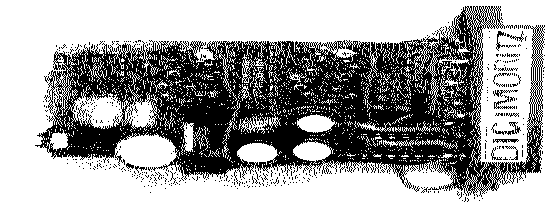

London (dpa) - Die anglikanische Kirche in Großbritannien hat eine
biblische Botschaft in den Pokemon-Figuren entdeckt, den derzeit gefragtesten Helden im Kinderzimmer.
Die japanischen Zeichentricktierchen
streiten demnach gegen teuflische
Kräfte, lieben einander, opfern sich
für ihren Nächsten und erlösen sich
von dem Bösen. Wo der Laie nur Action
und Krieg zu erkennen vermag, sieht
Dr. Anne Richards, Theologin der
Missionsabteilung der Church of
Engalnd, ein Ringen um fundamentale
Fragen nach Sinn und Sein: "Was bin
ich? Warum bin ich hier?" Richards
hatte von der Kirche den Auftrag bekommen
zu prüfen, ob die Pokemon-Geschichten bei der Missionsarbeit
verwendet werden könnten. "Zuerst fand
ich das sehr schwer", gab sie im
Guardian zu. Doch dann hätten sich ihr
"nahe liegende christliche Parallelen"
erschlossen.
Aus: SZ vom 10./11./12. Juni 2000 (Pfingsten), S. 14
Mumpitz als Heft gibt es monatlich bei
Hans-Christof Tuchen