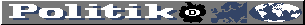
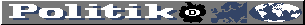
Nun ist er also da - der Atomkonsens. Das Atomzeitalter scheint damit in Deutschland der Vergangenheit anzugehören, wenngleich angesichts der vereinbarten Gesamtlaufzeiten der Slogan "Vorwärts in die Vergangenheit" dem Kommentator deutlich näher liegen dürfte als ein markiges "Zurück in die Zukunft". Eigentlich sollte damit allen gedient sein: Die "Grünen" konnten ihr Versprechen wenigstens zum Teil einlösen und ihrer Wählerschaft den "Einstieg in den Ausstieg" präsentieren, die Energiewirtschaft kann ihre Meiler bis weit jenseits der Rentabilitätsgrenze betreiben und der Bürger muss weder immense Schadensersatzforderungen mit seinen Steuergeldern begleichen noch von heute auf morgen Omas Petroleumlampe entstauben. Doch warum herrscht dennoch Missmut allenthalben, warum ist weder der Großteil der Atomgegner noch der der -befürworter konsent mit diesem Konsens ?
Die Antwort scheint klar. Mit einem Atomausstieg, so wetterte Greenpeace schon am 15. Juni in umgehender Reaktion auf den Energiekonsens, habe die Vereinbarung "nichts zu tun". Vielmehr garantiere der Konsens den AKW-Betreibern "eine Betriebsgenehmigung auf Lebzeiten". Ganz anders sieht das Winfried Münster, der am 18. April, also noch mitten in der Diskussion um den Atomkonsens, in einem Editorial der "Rheinischen Post" über "Ideologen" in der Bundesregierung wetterte, die "verbohrt und sinnlos" Kräfte vergeudeten, "die wahrlich Vernünftigerem dienlich gemacht werden könnten". Angesichts der Tatsache, "dass dies offizielle bundesdeutsche Politik ist", müsse man sich fragen, wie dieses Land nur regiert werde.
Doch erstaunlicherweise liegen die Umweltschützer und der entrüstete Journalist in der Sache bei weitem nicht so weit auseinander, wie es den Anschein haben mag. Denn für beide ist klar: "Für ein langsames Auslaufen der Reaktoren in zwanzig oder mehr Jahren hätte es keinen Konsens gebraucht", schimpft Greenpeace, und Münster sekundiert, es sei "seit langem klar, dass sich das Thema Atomstrom mit der Zeit von selbst erledigen würde". Man setze eine Entwicklung politisch durch, "die sich ohnehin vollzieht". Dass angesichts derart trauter Einigkeit die Drohung der Radikalopposition, der sich erfolgreich schon seit Jahren der Moderne verweigernden CSU, gegen den Atomkonsens gerichtlich vorzugehen, so platt wirkt wie sie denn tatsächlich auch ist, sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gräben zwischen den Lagern nach wie vor tief sind. Während Greenpeace als Grund für das ohnehin besiegelte Ende der deutschen Kernkraftwerke vage darauf verweist, dass "der Bau neuer Atomkraftwerke schon seit Jahren wirtschaftlich unattraktiv ist", sieht sich Münster im Angesichte "fast prohibitiv hinaufgeschraubter Sicherheitsstandards, erratisch urteilender Richter und (..) (von) Castor-Transporten, zu deren Schutz ganze Polizei-Armeen mobilisiert werden müssen".
Aber eine solche Sicht der Dinge verstellt nur den Blick auf deren Kern. Denn der Atomkonsens ist nichts weiter als ein weiteres Beispiel für das Politikverständnis des vielgesichtigen Gerhard Schröder, der einerseits als Anwalt des Volkes auftritt, sich andererseits aber auch in der Rolle als "Genosse der Bosse" gefällt. Wie kaum ein Bundeskanzler vor ihm hat er die alte Weisheit verinnerlicht, derzufolge Politik die "Kunst des Möglichen" ist. Und so war eben auch der Atomkonsens ein Kompromiss, der zwar einerseits bei niemandem wahre Begeisterung hervorgerufen hat - auch beim Verfasser dieser Zeilen nicht, der einen radikaleren Schnitt nicht nur für wünschenswert, sondern auch für politisch und rechtlich durchsetzbar gehalten hätte. Der gefundene Kompromiss hat aber auch, vielleicht eben gerade weil er vom jeweils anderen nicht als Triumph vereinnahmt werden konnte, beinahe niemandem so richtig weh getan. Und die politische Großwetterlage lief dann auch auf den gefundenen Konsens hin. Einerseits brauchten die "Grünen" nach dem Kosovo-Einsatz der Bundeswehr und weiteren Demütigungen der einst so prinzipienverliebten Partei endlich einen Erfolg, um die eigenen Reihen halbwegs geschlossen halten zu können. Andererseits erschien aber eine offene Konfrontation mit der Energiewirtschaft nicht ratsam: das im eher agraisch strukturierten Schröder-Heimatland Niedersachsen mühsam aufgebaute Image des "Modernisierers" hätte gelitten, der noch unter den Folgen der Kohl-Krise leidenden Opposition wäre eine propagandistische Steilvorlage geliefert worden, verhaltene Förderungsmaßnahmen alternativer Energien (Windenergie, 1000-Dächer-Programm) hätten sich verstärkem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt gesehen und endlose Rechtsstreitigkeiten waren im Falle eines Scheiterns der Konsensverhandlungen zu erwarten gewesen. Kurzum: Der gefundene Kompromiss ist ohne Zweifel ein Minimalkompromiss. Aber dass sich alle Beteiligten durchringen konnten, sich mit diesem zu begnügen, ist der eigentliche Erfolg der Energiekonsensgespräche. Seine befriedende Wirkung sollte - allen Differenzen in der Sache zum Trotz - keinesfalls unterschätzt werden, von der psychologischen Motivation, die aus dem zumindest formellen Schlussstrich unter eine schier endlose Debatte gezogen werden konnte, ganz zu schweigen. Verlierer sind letzten Endes vor allem die eigentlichen Ideologen, also diejenigen, die den Konflikt zur eigenen Selbstdarstellung benötigten, zur Abgrenzung vom gesellschaftlichen und politischen Gegner. Er ist sicher, und das wird jeder zu Recht bedauern, der Utopien und Prinzipien für unverzichtbar hält, auch eine Niederlage der Ideale - auf beiden Seiten -, vor allem aber ist der Atomkonsens ein Triumph des Möglichen.
Dass das Rufen der Kritiker (beider Seiten) denn auch gelegentlich an ein Rufen im Walde erinnert, wird denn auch in mancher hohlen Phrase deutlich, die da im Überschwange der Entrüstung gedroschen wird. So schließt Münster sein Editorial mit einem Rückblick in eine "Zeit, und zwar unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler", in der "die heimische Kern-Technologie Weltspitze" war, "und ein Exportschlager dazu". Nicht ohne Grund hatte schon Bert Brecht erkannt, dass der, der "A" (was, der Zufall will es so, auch der Anfangsbuchstabe der hier in Rede stehenden "Atomkraft" ist) sagt, nicht unbedingt auch "B" sagen muss. Er kann vielmehr durchaus zu der Erkenntnis kommen, dass schon das "A" ein Fehler war. Und wenn Münster beklagt, dass "deutscher Atomstrom" nun "endgültig durch französischen ersetzt wird", dann möchte man beinahe darüber klagen, dass es mal eine Zeit gab, in der deutsche Pharmakonzerne in der Herstellung von Heroin Weltspitze und der vermeintliche Hustensaft ein Exportklassiker war, diese "glorreiche" Technologie jedoch von der ignoranten deutschen Politik zu Grunde gerichtet und das Geschäft fatalerweise Kolumbien überlassen wurde. Nur dem letzten Satz Münsters möchte man da wieder uneingeschränkt zustimmen: "Man fasst sich an den Kopf."

Der Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung von Hans-Joachim Stengert.